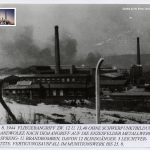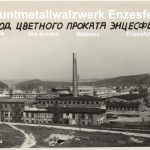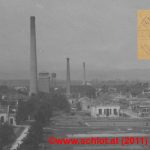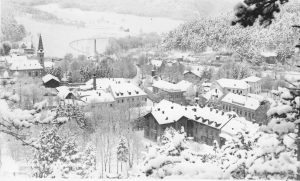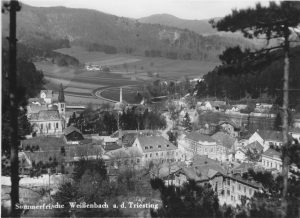Am 19.05.1891 wurde in den U.S.A. der heute allseits bekannte Kronkorken als Getränkeverschluß patentiert [1].
Um 1925 wurde in Schweden ein neuartiger Verschluss für Getränkeflaschen erfunden, der von etwa 1930 bis 1980 eine rege Verbreitung verzeichnete; es handelte sich um eine abreißbare Aluminiumkapsel, unter der eine Lage Presskork eingelegt war. Diese ab 1933 als ALKA-Kapsel (ALuminium-KApsel) bezeichnete Erfindung feierte große kommerzielle Erfolge [2] und wurde wohl bereits relativ früh kopiert bzw. in Lizenz produziert.
In Wiener „Adolph Lehmann’s allgemeiner Wohnungs-Anzeiger“ tritt die Firma „Alkaverschluß Jonsson & Co, XVII, Ottakringer Straße 36 […]“ bereits 1930 auf [3].
1938 macht ein alteingesessenes Unternehmen, die Fa. „Österreichische Kronenkornwerke Richard Bruchsteiner, Wien XIX, Bachofengasse 8“, bereits mit einer Produkt-Erweiterung auf „Aluminium-Abreißverschlüsse“ Konkurrenz [4].
1942 firmierte „Alkaverschluß Jonsson & Co“ in Wien I, Reichsratstraße 5 und Wien I, Doblhoffgasse 9 [5].
1953 inserierte im ATB (allgemeinen Telephonbuch Wien) die Firma als „Flaschenverschlüsse Original Alka“ in Wien I, Doblhoffgasse 9. Unverblümte Konkurrenz boten damals „ Josef Frais, Wien XVII., Blumengassse 11, Fabrikation von Aluminium-Abreißverschlüssen […] sowie die „Metallkapsel- und Korkenfabrik Viktor Perry, Wien III., Ungargasse 59-61“ [6].
1972 inserierten im ATB die Firma „Alkaverschluß Timmel, 1151 Wien, Rauchfangkehrergasse 37“ und „JOMA – Johann Matzka, 1070 Wien, Kaiserstraße 33, Korke, Flaschenverschlüsse aller Art […]” [7].
1975 inserierte im ATB die Firma Timmel als „CROWN CORK GMBH Timmel, 1151 Wien, Rauchfangkehrergasse 37,“ und „Alkaverschluß Timmel, 1151 Wien, Rauchfangkehrergasse 37“ und hat dieselbe Konkurrenz wie schon 1972 [8].
Die Alka-Kapsel auf Bierflaschen der Schwechater Brauerei wurden mit der ab 1975 ausgestrahlten umstrittenen Fernsehserie „ Ein echter Wiener geht nicht unter“ dokumentiert [9][10, Minute 0:58]. Ihre Spur auf Flaschenhälsen verliert sich wohl um 1980.
Das Archiv schlot.at besitzt eine Sammlung von Abrisskapseln des 20. Jahrhunderts, die nach derzeitigem Kenntnisstand auf Bier-, Mineralwasser-, Limonaden- und Essigflaschen einsetzt wurden [11].
Vertreten sind derzeit Kapseln folgender Hersteller bzw. Marken:
Brauereien:
- Brauerei Liesing
- Brauerei Neu Nagelberg
- Brauerei Nussdorf
- Brauhaus Dreher Schwechat
- Schwechater Bier
- Hubertus Bräu
- Linzer Bier
- Wiener Stadtbräu Lager
- Wiener Stadtbräu Steffel
Limonaden:
- Almdudler Limonade
- Florida Gold
- Frucade
- Libella Rubin
- Peregrini
- Schartner Bombe
Privat-Abfüller/Mineralwasser:
- E. Walter Fischamend
- Eis-Soda Hainburg
- Georg Pschick Wien XXI
- Gleichenberger Mineralwasser
- Karl Kiefer Wien XXI
- KEME
- RGE (Reiner Gärungs-Essig)
- Thalheimer
Quellen:
[1]…wissenschaft.de (17.01.2024)
[2]…digitaltmuseum.se (17.01.2024)
[3]…Wienbibliothek – Lehmann 1930 (17.01.2024)
[4]…Fernsprechnetz Wien – Amtliches Teilnehmerverzeichnis, Ausgabe Mai 1938, S. 69
[5]…Wienbibliothek – Lehmann 1942 (17.01.2024)
[6]…Amtliches Telephonbuch Wien 1953, II. Teil: Berufs- und Branchenverzeichnis, S. 256 ff
[7]…Amtliches Telephonbuch Wien 1972, Berufs- und Branchenverzeichnis, S. 334
[8]…Amtliches Telephonbuch Wien 1972, Berufs- und Branchenverzeichnis, S. 390
[9]…falstaff.com (17.03.2024)
[10]…youtube.com (17.03.2024)
[11]…Abrisskapseln im Eigentum Archiv schlot.at